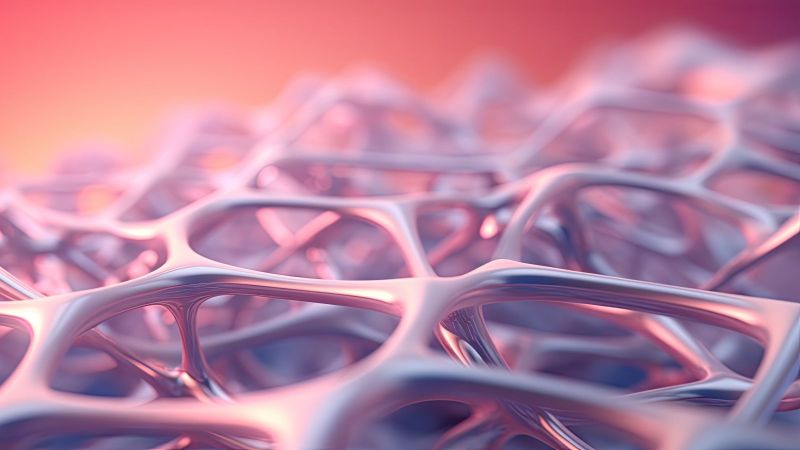04.04.2025 TransHyDE
Abschlusskonferenz: TransHyDE präsentiert Ergebnisse nach 4 Jahren Projektlaufzeit
Seit dem Projektstart im April 2021 haben die über 100 Partner im Wasserstoff-Leitprojekt TransHyDE die Forschung und Entwicklung verschiedener Transport- und Speicheroptionen vorangetrieben. Bei der Abschlusskonferenz des Projekts präsentierten die Partner vom 25. bis 27. März 2025 ihre Ergebnisse und widmeten sich in Paneldiskussionen wichtigen übergreifenden Fragestellungen zur Zukunft des Wasserstofftransports.
Forschung und Entwicklung von Transport- und Speicheroptionen
Mit der Nationalen Wasserstoffstrategie will die Bunderegierung klimafreundliche Wasserstofftechnologien vorantreiben und somit den Wasserstoffhochlauf unterstützen.
Dafür ist der Aufbau einer geeigneten Wasserstoffinfrastruktur elementar.
Hier setzte TransHyDE im Jahr 2021 an: Das Projekt erforscht und entwickelt die Transportmöglichkeiten für gasförmigen Wasserstoff (gH₂), flüssigen Wasserstoff (LH₂), Ammoniak (NH₃) sowie für flüssige organische Wasserstoffträger (Liquid Organic Hydrogen Carriers, kurz: LOHC). Zudem hat sich das Projekt auch mit den Rahmenbedingungen und Normen des Wasserstofftransports auseinandergesetzt.
Die vielfältigen Fortschritte und Ergebnisse stellten die TransHyDE-Projekte in ihren umfangreichen Ergebnispräsentationen vor. Begleitend dazu zeigten viele Partner Exponate und Poster, die die Forschungsinhalte veranschaulichten.
Transport von gasförmigem Wasserstoff
Das Projekt GET H2 hat im vergangenen Jahr ein Pilot-Wasserstoffnetz in Betrieb genommen, um umgewidmete Erdgas-Leitungen für den Wasserstofftransport und als Vorbereitung für das Wasserstoffkernnetz zu testen. Hier können die Partner verschiedene Technologien sowie Komponenten testen und weiterentwickeln. Damit wird eine verlässliche Grundlage für den Betrieb des Wasserstoffkernnetzes geschaffen.
Gasförmiger Wasserstoff kann ebenfalls in Hochdruck-Kugelspeichern transportiert werden, um Wasserstoff auch an die Orte zu bringen, die nicht unmittelbar mit dem Kernnetz verbunden sind. Die Partner aus dem TransHyDE-Projekt Mukran konzipierten einen containerisierten Speichertank, der auch auf der Konferenz im Futurium ausgestellt wurde.

Transport von flüssigem Wasserstoff
Das TransHyDE-Projekt AppLHy! entwickelte in der Projektlaufzeit unter anderem Geräte zur Füllstandssensorik. Die Geräte helfen beispielsweise dabei, den energetischen Aufwand bei der Verflüssigung sowie die Verluste beim Umfüllen möglichst zu minimieren. Mit diesen anwendungsbezogenen Technologien kann der potenzielle Einsatz von Flüssigwasserstoff effizienter gestaltet werden.

Transport von Ammoniak
Wird Wasserstoff in Ammoniak gebunden, können bestehende Infrastrukturen für den Transport genutzt werden. Das macht das Verfahren zu einem wichtigen Forschungsgegenstand. Das TransHyDE-Projekt
AmmoRef arbeitet an effizienten Katalysatoren, die benötigt werden, um den Wasserstoff nach dem Transport wieder vom Ammoniak zurückzugewinnen. Zur Kostensenkung und Schonung der Umwelt soll ihr Edelmetallanteil möglichst reduziert werden.
Transport von LOHC
Die Partner aus dem TransHyDE-Projekt Helgoland entwickelten während der Projektlaufzeit einen mobilen LOHC-Tank mit einer integrierten Zwischendecke. Somit kann zeitgleich in einem Tank durch die Zwischendecke getrennt beladenes LOHC (mit Wasserstoff) und unbeladenes LOHC (ohne Wasserstoff) transportiert werden.
Umfassende Rahmenbedingungen für den Transport von Wasserstoff
Für eine funktionierende Wasserstoffinfrastruktur sind Normen und Standards unerlässlich. TransHyDE hat sich in den vergangen Jahren deshalb auch mit technischen Regelwerken und der regulatorischen Dimension auseinandergesetz und wichtige Erkenntnisse erarbeitet.
Die Partner im TransHyDE-Projekt Norm haben im Laufe der Projektzeit eine Bedarfsanalyse durchgeführt, um Lücken in der Regelsetzung zu identifizieren. Auf dieser Grundlage haben sie Handlungsempfehlungen formuliert und begonnen Lücken in der Regelsetzung zu schließen, die den Hochlauf der Wasserstofftechnologien unterstützen sollen.
Rund um den Transport von Wasserstoff spielen (LNG-)Terminals eine besondere Rolle in der Infrastruktur. Die Partner aus dem TransHyDE-Projekt erarbeiteten eine wissenschaftliche Datenbasis, auf deren Grundlage die Partner Empfehlungen für zukunftsfähige und langfriste Nutzung von LNG-Terminal-Standorten geben können. Diese sollen auch als logistische Knotenpunkte für Wasserstoff und seine Derivate (z. B. Ammoniak, Methanol, SNG, LOHC) genutzt werden.
Wie entwickeln sich die Wasserstoffinfrastruktur und der Hochlauf in Zukunft?
Diesen Fragen gingen die Partner im TransHyDE-Projekt Systemanalyse nach. Sie betrachteten den Wasserstofftransport im gesamten Energie- und Wirtschaftssystem. Die Partner modellierten Nachfrage und Bedarf von Wasserstoff im Hinblick auf die räumliche und zeitliche Entwicklung. Auf der Abschlusskonferenz stellte das Projekt die finale digitale Roadmap vor. Abrufbar ist die umfangreiche Roadmap unter: https://www.transhyde.de/

Die TransHyDE-Abschlusskonferenz zeigte die umfangreichen und vielfältigen Ergebnisse, die die Partner über vier Projektjahre erarbeitet haben. Auf dieser Grundlage können die Wasserstoff-Transporttechnologien und der Wasserstoff-Hochlauf weiter vorangetrieben werden.
Finalisierung der Arbeiten bis Ende 2025
Einige Meilensteine in den TransHyDE-Projekten stehen allerdings für dieses Jahr noch an:
- Das TransHyDE-Projekt CAMPFIRE nimmt das COIL CAMPFIRE Open Innovation Lab in Betrieb. Hier sollen verschiedene Ammoniak-Anwendung getestet werden.
- Außerdem plant das TransHyDE-Projekt AppLHy! die Fertigstellung ihrer Flüssigwasserstoff-Pipeline, mit der es den parallelen Transport von Wasserstoff und Strom erproben wird.